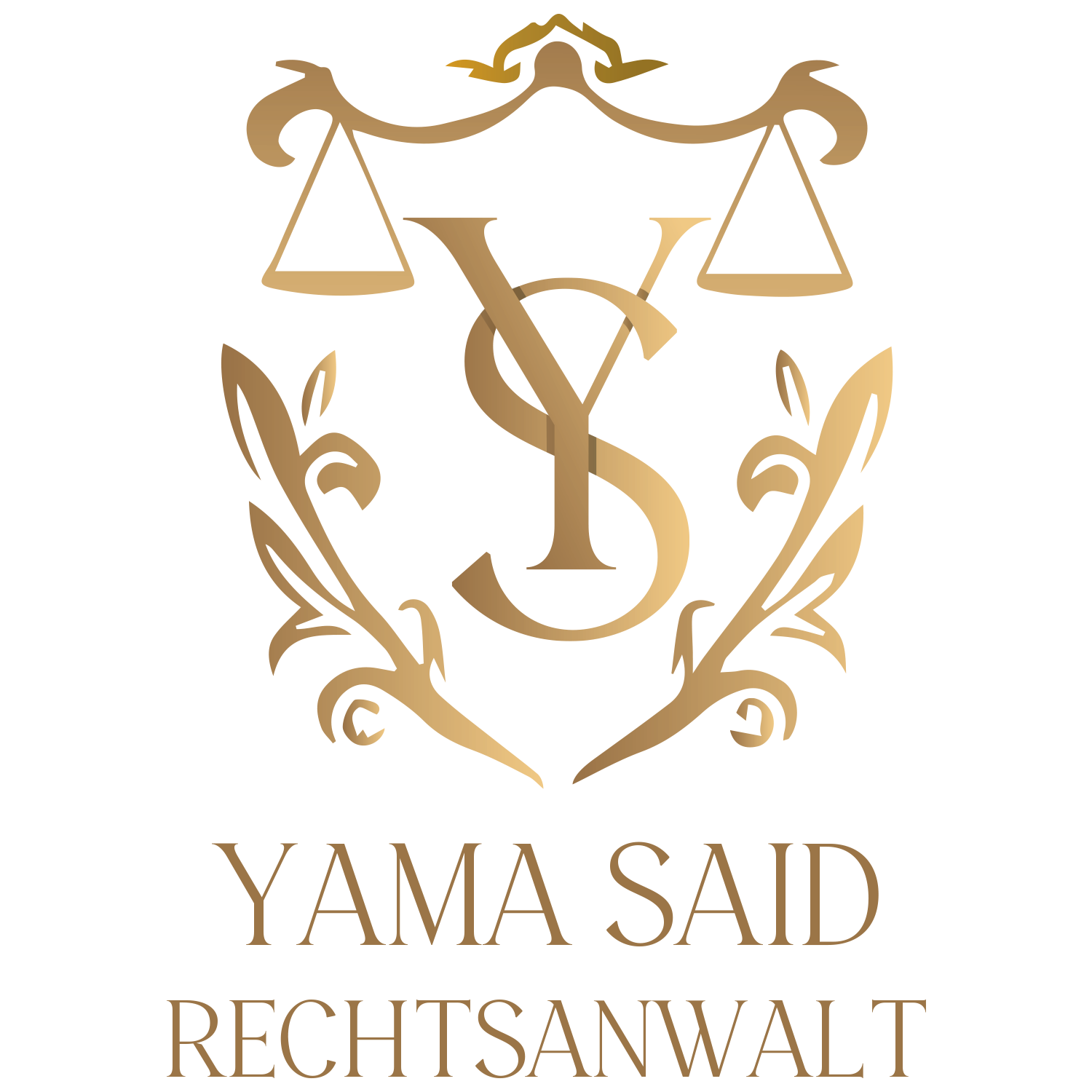Wie viel Platz muss die Religion im modernen Arbeitsleben haben , ist eine Frage, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) bald entscheiden muss. Die Antwort auf diese Frage wird von grundlegender Bedeutung sein.
Das deutsche Grundgesetz (GG) stuft die Glaubens- und Religionsfreiheit als unverletzlich (Art. 4 Abs. 1 GG) ein und gewährleistet deren ungestörte Ausübung (Art. 4 Abs. 2 GG). Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet Diskriminierungen wegen der Religion (§ 1 AGG). Ein ähnliches Bild zeichnet sich auf supranationaler Ebene ab: Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und ebenso die Grundrechtecharta (GrC) schützen die Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK, Art. 10 GrC), die ebenfalls in der dem AGG zugrundeliegenden Antidiskriminierungsrichtlinie RL 2000/78/EG (Art. 1) geschützt ist. Es besteht daher kein Streit über den grundsätzlichen Schutz religiöser Überzeugungen.
Verfassungsrechtlich, arbeitsrechtlich und auch gesamtgesellschaftlich kontrovers diskutiert wird hingegen, WIE WEIT die Religionsausübungsfreiheit in das Arbeitsleben hineinreichen darf und ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Unternehmen in diesen Bereich sichtbar gezeigter religiöser Zeichen eingreifen dürfen.
Unternehmen dürfen das Tragen auffälliger religiöser Zeichen im Betrieb verbieten, findet jedenfalls EuGH-Generalanwalt Rantos in seinen Schlussanträgen. Kleine und unauffällige Zeichen dürften hingegen erlaubt sein – jedenfalls dann, wenn das jeweilige nationale Verfassungsrecht dies zur Wahrung der Religionsfreiheit gebiete.
Zwei deutsche Fälle tragen eine Grundsatzfrage nach Luxemburg
Die Anrufung des EuGH geht zurück auf gleich zwei Arbeitsrechtsstreitigkeiten vor deutschen Arbeitsgerichten. Zum einen ging es um das Verbot des Tragens sichtbarer religiöser Zeichen in einem Drogeriemarkt in Stuttgart (Az. am EuGH: C-341/19). Eine dort beschäftigte Verkäuferin beabsichtigte, nach Rückkehr aus der Elternzeit aufgrund ihres Glaubens als Muslima auch während der Arbeitszeit ein Kopftuch zu tragen. Der Weisung des Arbeitgebers, dieses zur Wahrung der Neutralität im Betrieb abzulegen, kam sie nicht nach. Daraufhin wurde sie nicht mehr beschäftigt. Hiergegen klagte die Verkäuferin und machte ihr Recht auf Beschäftigung (mit Kopftuch) und Annahmeverzugslohn geltend. Das Arbeitsgericht Nürnberg (Urt. v. 28.3.2017, Az. 8 Ca 6967/14) und das Landesarbeitsgericht Nürnberg (Urt. v. 27.3.2018, Az. 7 Sa 304/17) gaben der Mitarbeiterin Recht und sahen in dem Kopftuchverbot eine mittelbare und unzulässige Diskriminierung aufgrund der Religion. Der Arbeitgeber berief sich im Revisionsverfahren zum Bundesarbeitsgericht (BAG) auf seine unternehmerische Betätigungsfreiheit und den Wunsch betrieblicher Neutralität. Dieses setzte das Verfahren sodann aus (Beschl. v. 30.1.2019, Az. 10 AZR 299/18 (A)) und legte dem EuGH die Frage zur Entscheidung vor, ob betriebliche Neutralitätsvorgaben und die unionsrechtlich geschützte unternehmerische Betätigungsfreiheit einen solchen Einschnitt in die verfassungsrechtlich geschützte Religionsfreiheit erlaubten.
Zum anderen verhandelt der EuGH (Az.C-804/18) den Fall einer Erzieherin einer Hamburger Kindertagesstätte, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern per Dienstanweisung das Tragen sichtbarer religiöser Zeichen während der Arbeit untersagt hatte. Eine mit Kopftuch zur Arbeit erscheinende Erzieherin wurde daher abgemahnt und setzte sich dagegen gerichtlich zur Wehr. Das ArbG Hamburg (Beschl. v. 21.11.2018, Az. 8 Ca 123/18) setzte das Verfahren aus und bat den EuGH um Vorabentscheidung, ob das Unionsrecht betriebliche Neutralitätsvorgaben erlaube.
Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wiederholt betont und im Jahr 2015 in einer grundlegenden Entscheidung ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen als verfassungswidrig qualifiziert (Beschl. v. 27.1.2015 – 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10). Ein solches Verbot sei nur erlaubt, wenn es zu „einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität“ komme.
Ein allgemeines Gebot der religiösen Neutralität ist nur dann verfassungskonform, wenn die Person mit religiösen Zeichen unmittelbar den Staat in einer klassischen Über-Unterordnungssituation repräsentiert – wie es etwa bei Rechtsreferendarinnen etwa bei Sitzungsvertretungen während der Ausbildung der Fall ist (vgl. zuletzt BVerfG, Beschl. v. 14.01.2020, Az. 2 BvR 1333/17).
Das BAG hat diese Sichtweise erst kürzlich bestätigt und einer Kopftuch tragenden Muslima eine Entschädigung zugesprochen, die entgegen den Regelungen im Berliner Neutralitätsgesetz ihr Kopftuch während des Unterrichts nicht ablegen wollte und daher bei der Bewerbung unberücksichtigt blieb (Urt. v. 27.08.2020, Az. 8 AZR 62/19).
Das Erfordernis „konkreter Störungen“ für betriebliche Neutralitätsvorgaben verlangt die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zudem für Arbeitgeber in der Privatwirtschaft und dies im Übrigen auch bereits zeitlich weit vor den Vorgaben des Verfassungsgerichts aus 2015: Ein Kopftuchverbot führe nicht dazu, dass eine Verkäuferin ihre Tätigkeit nicht mehr erbringen könne.Ein Arbeitgeber müsse konkret darlegen, inwieweit seine unternehmerische Betätigungsfreiheit hierdurch beeinträchtigt werde (BAG, Urt. v. 10.10.2002, Az. 2 AZR 472/01).
Der Vorschlag des Generalanwalts: „kleine“ Symbole erlaubt
Die europäische Sichtweise betont dagegen seit jeher die unternehmerische Freiheit in stärkerem Maße. Danach kann das Verlangen eines neutralen Auftretens einer Mitarbeiterin im Empfangsbereich des Unternehmens, wo es zu direktem Kundenkontakt kommt, gerechtfertigt sein, wie der EuGH 2017 bereits einmal entschied (Urt. v. 14.3.2017, Az. C-157/15).
In seinen Schlussanträgen vom Donnerstag vertritt der Generalanwalt dagegen eine differenzierende Sichtweise: Das sichtbare Tragen von kleinen politischen, religiösen oder weltanschaulichen Zeichen stehe einer vom Arbeitgeber bezweckten Neutralitätspolitik nicht entgegen. Was „klein“ sei, müssten die nationalen Gerichte im Einzelfall bestimmen. Ein Kopftuch sei hingegen kein bloß kleines religiöses Zeichen, sodass dessen Zulässigkeit die nationalen Gerichte im Einzelfall prüfen müssten. Bei einem absoluten Verbot religiöser Zeichen nach dem Wunsch des Arbeitgebers sei hingegen auch das jeweilige nationale Verfassungsrecht zu beachten.
Das deutsche Verfassungsrecht verlange zwar, so der Generalanwalt, eine konkrete Störung. Diese Vorgabe sei aber mit dem Unionsrecht vereinbar, da es keine Neutralitätspolitik verbiete, sondern nur eine weitere Anforderung an diese setze. Daher dürfe ein nationales Gericht weiterhin die verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Schutz der Religionsfreiheit beachten.
Die Folge: Konflikt zwischen Unions- und Verfassungsrecht?
Nun ist ein Schlussantrag des Generalanwalts keine verbindliche Entscheidung. Der Generalanwalt am EuGH hat aber – übertragen in das deutsche Recht – eine Rolle, die mit einem Richter als Berichterstatter am ehesten vergleichbar ist, der eine Sache für eine Kammer oder einen Senat vorbereitet und eine Entscheidungsempfehlung abgibt. Daher folgt der EuGH in seinen späteren Entscheidungen oftmals – jedenfalls in der Grundtendenz – den Schlussanträgen seiner Generalanwälte. Zwingend ist dies aber nicht. Insoweit bleibt es spannend, wie das Urteil ausgeht.
Fällt die Entscheidung aber so aus, wie der Generalanwalt plädiert, so bleiben Abwägungen im Einzelfall weiterhin erforderlich. Nationale Gerichte werden zunächst klären müssen, was denn „kleine“ Zeichen sind. Ein Kopftuch ist dies nicht, wie der Generalanwalt bereits zu bedenken gibt.